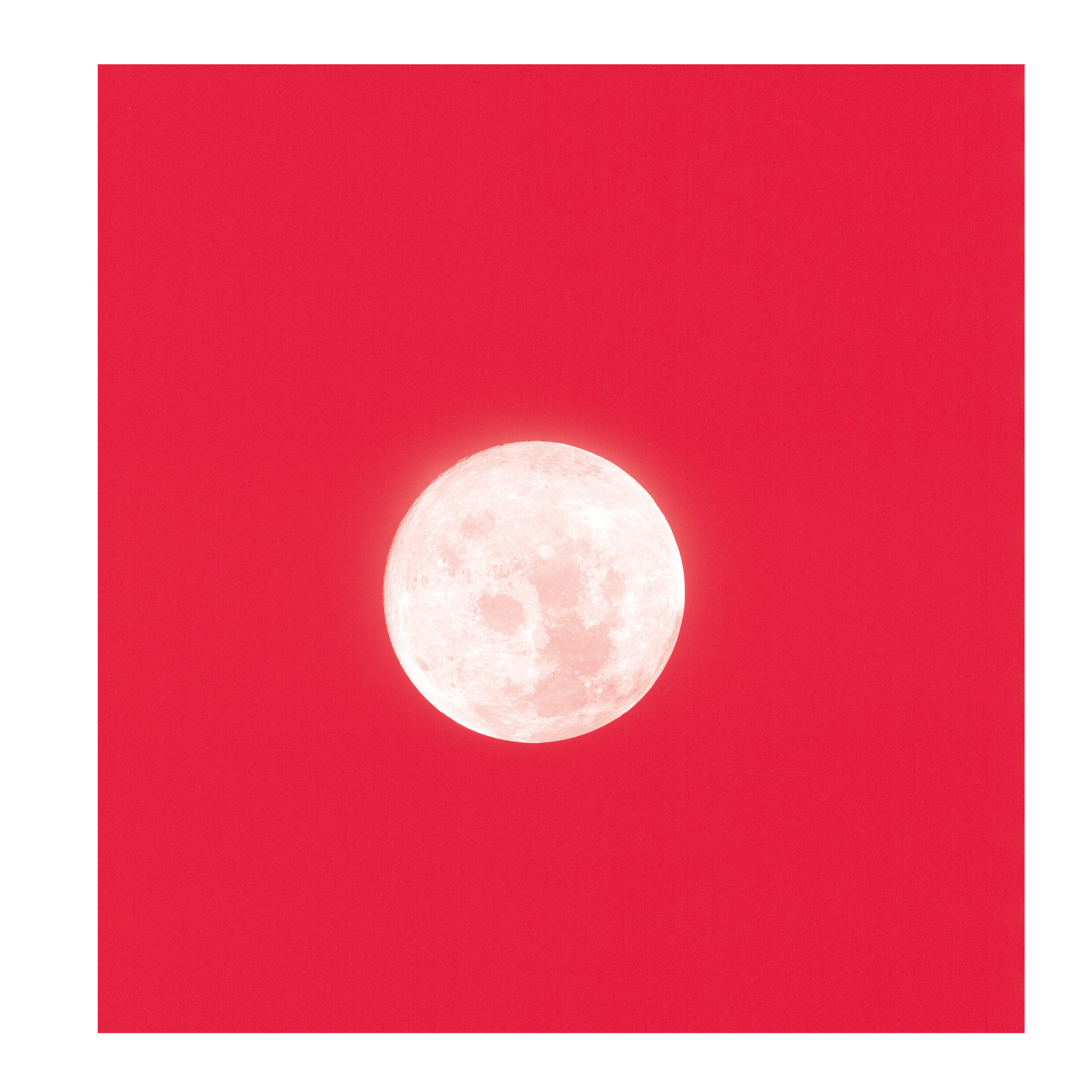| Marie Eisenmann |
Wie die subtile Annahme von Männern, Frauen seien dümmer oder unwissender als sie, darin gipfelt, dass ihr ein Mann nicht nur ein Buch, sondern die Bibel und die Menschheit erklären möchte, verarbeitet Marie Eisenmann in diesem Essay.
Ich will sie doch gar nicht, denke ich mir, als der Buchhändler zur Empfehlung ansetzt. Gerade suche ich in seinem Laden nach einem italienischen Buch, weil ich Urlaub in der Toskana machen will. Ich fühle mich gerne ein wenig intellektuell, wenn ich im Zug sitze und die Landschaft an mir vorbeizieht und meine Erfahrung dabei von jemand anderem in Worte gefasst wird. Um mich herum lauter Geschichten einsamer Männer, die sich in die Berge oder abgelegene Dörfer zurückziehen, um sich den großen Fragen ihres Lebens zu stellen. Ich stelle mir vor, wie mir all diese Männer mit Leidensmiene in der Toskana begegnen und will gehen, bevor ich beschließe, meinen Urlaub abzusagen. Ich will gerade den Laden verlassen, da kommt der Buchhändler: „Soll es etwas für dich sein oder suchst du nach einem Geschenk?“ Ich zögerte zu lange.
„Was hast du als letztes gelesen?“, fragt er jetzt weiter. Die Überzeugung, dass er unabhängig von meiner Antwort das richtige Buch empfehlen wird, steht ihm ins Gesicht geschrieben. „Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf“, antworte ich. Es folgt eine Szene, die einem Hörtest ähnelt. „Christa T.?“, schreit er, die Fragezeichen in seiner Stimme werden unterstrichen durch seine hochgezogenen Augenbrauen. Er wirkt verwirrt, was mich verwirrt, weil ich nicht verstehe, was ihn verwirrt. Vielleicht zu viele Christas auf einmal, denke ich und wiederhole den Satz. Langsam mit Pause zwischen Titel und Autorin. „Christa T.?“, unterbricht er mich. Ich antworte bestätigend. „Ja, Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf. Er schreit noch einmal. Ich nenne den Titel ein viertes Mal, betone diesmal, dass das Buch von Christa Wolf geschrieben sei. Er meint: „Sagt mir gar nichts.“ Die Färbung seiner Stimme deutet darauf hin, dass er es für wahrscheinlicher hält, dass ich mir dieses Buch ausgedacht habe, als dass er es nicht kennen könnte. Verwirrt von unserem Schlagabtausch, ziehe ich aus Höflichkeit noch ein paar Bücher aus dem Regal, die ich nicht kaufen werde. Insgeheim bin ich froh, weil ich vermute, dass auch er es nicht schaffen wird, mir eine Empfehlung auf Basis eines erfundenen Buchs zu geben.
Als ich mir gerade ein Buch, vor allem aber wegen des schönen Covers, zur Hand nehme, ruft er mir zu: „Da stehen Sie richtig!“, pausiert kurz, „Das ist von einem vergessenen Autor aus der Sowjetunion.“, pausiert noch einmal. „Er hat dadaistische Gedichte geschrieben“. Während ich noch darüber nachdenke, wo genau die Parallele zu Christa Wolf verläuft, reicht der Buchhändler mir Meister und Margarita von Michail Bulgakow. „Auch ein für lange Zeit vergessenes Werk!“, ruft er aus und erzählt mir ungefragt die ganze Editionsgeschichte. „Wann wurde es denn wiederentdeckt?“, frage ich, er zuckt nur mit den Schultern, zieht eine weitere Ausgabe des Buches aus dem Regal und legt die beiden Bücher vor mich. „Es wurde zweimal übersetzt. Die Übersetzungen sind aber grundverschieden. Du wirst schon sehen.“ Er räuspert sich, richtet sich auf, liest erst eine Stelle aus dem einen, dann aus dem anderen Buch laut und feierlich vor, als stünde er auf einer Kanzel und ich weit entfernt zu seinen Füßen. Anschließend blickt er mich über den Rand seiner Brille erwartungsvoll an. „Und? Sie merken den Unterschied, oder?“ Ich weiß nicht, ob er mich fragt, weil er völlig begeistert ist oder um sich zu vergewissern, dass ich ihn überhaupt verstanden habe.
Es ist nicht das erste Mal, dass mir ein Mann ungefragt etwas erklärt. Auf einer Party erzählten mir einmal zwei Männer, wie sich Frauen fühlen, wenn sie nachts allein nachhause laufen. Ein anderer Mann erklärte mir meinen Zyklus und wieso ich nach seinen Berechnungen bestimmt nicht schwanger werden könnte, obwohl er ja heimlich kein Kondom verwendet hatte. Es ist nicht einmal das erste Mal, dass ein Mann mir die Literatur erklärt, als hätte ich noch nie ein Buch gelesen. Viele dieser Männer sitzen in Uniseminaren und hören sich selbst gern beim Reden zu, als übten sie jeden Satz vor einem inneren Spiegel ein. Auf ihren MacBooks kleben manchmal Marx-Sticker. Beim Vortragen ihrer Literaturanalysen sagen sie gerne: „Wir müssen hier vorsichtig sein!“, ihr warnender Unterton gibt zu erkennen, dass wir alle im Seminarraum froh sein können, dass sie uns aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien, als Folge auf die Interpretation der Kommilitonin, die auf Geschlechterrollen in einem Roman aufmerksam macht und dabei kurz die Verdinglichung aus den Augen lässt, der Ausbruch des Faschismus in Deutschland.
Es ist nicht ihre Kritik, die mich ärgert, sondern die Selbstgefälligkeit, in der sie sich als die einzig wahren Ideologiekritiker inszenieren, stets auf der Hut, aber selten vorsichtig genug, um die sexistische Einsichtigkeit ihrer Kapitalismuskritik zu hinterfragen. Oder diese um ein bisschen Selbstkritik zu erweitern. Als ich nach einem solchen Seminar mit einer Freundin in der Mensa saß, fragten wir uns, woher die Angewohnheit, sich selbst stets als Universalgenie zu begreifen, kommen mag. „Vielleicht lässt sich eine direkte Linie zu Goethe ziehen“, sagte ich, „ein Goethe-Komplex gewissermaßen.“ Ganz unabhängig davon, wie bedeutend das Werk ist, dass er hinterlassen hat, fragten wir uns, ob auch Goethe vielleicht ein unfassbar anstrengender Kommilitone gewesen wäre.
Es ist nicht mehr originell, festzustellen, dass es Mansplaining gibt. Mansplaining zeichnet sich durch die Annahme aus, dass man als Mann qua seiner Männlichkeit über alles eben bisschen besser Bescheid wisse. Der Begriff des „Mansplainings“, wird meistens der Essayistin Rebecca Solnit zugeschrieben, deren Essay „Men explain things to me“ große Wellen schlug. Nach Veröffentlichung des Essays entstand eine Webseite „Academic men explain things to me“, auf der Frauen Situationen — vor allem im akademischen Bereich — schilderten, in denen ihnen Männer herablassend Dinge erklärt hatten, von denen sie mehr Ahnung hatten. Der Essay erschien 2008. Auch sechzehn Jahre später wird noch unaufgefordert erklärt. Vielleicht ist es ermüdend noch einen Text darüber zu lesen. Vielleicht ist die Ermüdung eines Tages ansteckend und Männer verlieren die Lust am Erklären.
Beim Buchhändler ist davon nichts zu merken, er steht immer noch neben mir. Ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Um meiner scheinbaren Verwirrung entgegenzuwirken, fasst er kurz den Plot zusammen, erwähnt, dass es in dieser Textstelle, die er mir vorgelesen hat, auch um Jesus und Pontius Pilatus geht. „Jesus und die Kreuzigung sind dir ein Begriff, oder?“ Völlig underground, große Ikone der Subkultur, denke ich mir. Man muss schon viel gelesen haben, um diesen Jesus zu kennen, und was der alles für crazy Sachen erlebt hat. Inzwischen bin ich ratlos, ob ich irritiert oder amüsiert von dem Buchhändler sein soll. „Ich glaube nicht, dass mir schon mal Jesus gemansplaint wurde“, sage ich später, wenn ich anderen von der Begegnung erzähle. Aauch dann erst fällt mir ein, was ihm alles entgegengesetzt hätte. Ich hätte gerne gesagt, dass er aufhören soll, so zu tun, als könne ich von Literatur keine Ahnung haben; dass ich eigentlich sogar Literaturwissenschaft studiere. Ich hätte gerne gefragt: „Wo genau ist die Verbindung zwischen Christa Wolf und einem beliebigen Autor aus der Sowjetunion, der in einem anderen Genre und in einem anderen Stil schreibt? Empfehlen Sie Leser*innen von Annie Ernaux auch Gedichte von Gottfried Benn, weil naja… Kapitalismus eben.“
Als die Wut verflogen ist, frage ich mich, welches Frauenbild hinter dem Mansplaining steckt. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich diesem entspräche? Einmal erzählte ich einem Mann, dass mir ein Buch von Haruki Murakami nicht gefallen hatte, weil mir die Frauenfiguren eindimensional und idealisiert vorkamen. „Ich würde das Buch einfach ein zweites Mal lesen. Wenn dir das Buch dann immer noch nicht gefällt, liegt es an Murakami“, antwortete er. Ich stelle mir vor, wie ich alles zwei Mal machen müsste, weil ich aufgrund meines mir zugeschriebenen Geschlechts eben nie meinem ersten Urteil trauen könnte. Jede Hausarbeit müsste ich nach dem Schreiben komplett löschen, weil ich mich währenddessen in der Irrationalität meines Frauseins verlieren würde und immer zwei Versuche bräuchte, um klar denken zu können. Keine meiner Erfahrungen könnte ich in Worte fassen, bis mir ein Mann das Patriarchat erklärt, keine Erfahrung könnte ich machen, bis mir ein Mann erklärt, was eine Erfahrung ist. In den Augen der mansplainenden Männer bin ich vielleicht für immer ein kleines Mädchen, das langsam und durch ihre Hilfe beginnt, die Welt zu begreifen. Ich wäre verwirrt von meinem Spiegelbild, bis mir ein Mann sagt, wer ich bin. Vielleicht würde ich mich nach langer Zeit sogar trauen, einen Mann zu fragen, was es mit der grotesken Deko des blutenden Mannes am Kreuz auf sich habe, die in Deutschland überall herumhing, aber die mir nie jemand erklärt hatte. Der Mann würde sich mir väterlich annehmen, mich auf seinen Schoß ziehen und erstmal von vorne die Geschichte der Menschheit erzählen. „Am Anfang war das Licht…“